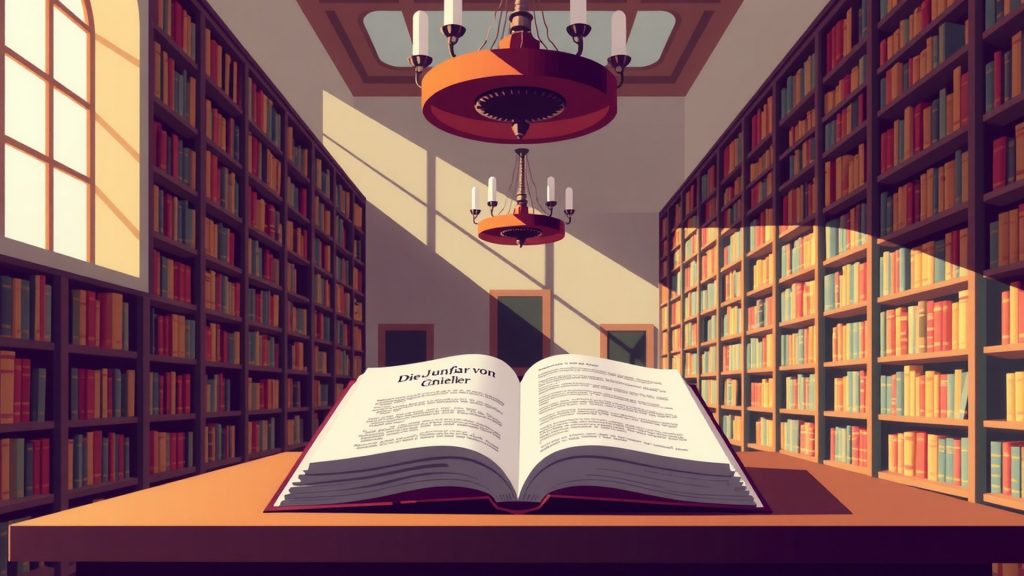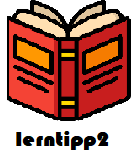Jungfrau von Orleans Schiller
Oktober 2, 2025
0
Von
fares87
Inhalt des Artikels
Die Tragödie der Jungfrau von Orleans
Einleitung
Friedrich Schiller schrieb Die Jungfrau von Orleans im Jahr 1801. Es handelt sich um ein Drama in fünf Aufzügen mit einem Prolog. Schiller greift hier auf eine historische Gestalt zurück: Jeanne d’Arc (Johanna von / von Orleans), die im Hundertjährigen Krieg für Frankreich kämpfte. Schillers Werk gehört zur Weimarer Klassik, zugleich weist es romantische Züge auf. Das Stück zeichnet sich durch seine Spannung zwischen religiöser Berufung, politischem Auftrag und persönlicher Schwäche aus.

Friedrich Schillers Drama „Die Jungfrau von Orleans“ erzählt die Geschichte von Jeanne d’Arc, die im Hundertjährigen Krieg für Frankreich kämpft. Das Stück thematisiert den Konflikt zwischen göttlicher Berufung und persönlichen Gefühlen, verkörpert durch die tragische Heldin Johanna. Mit romantischen und klassischen Elementen reflektiert es über Macht, Verantwortung und die Herausforderungen des Individuums in einer von politischen Intrigen geprägten Welt.
Die Bürgschaft Schiller - Video
Die Bürgschaft Schiller Interpretation

Historischer Hintergrund
Der Hundertjährige Krieg (1339–1453) war eine Reihe von Konflikten zwischen England und Frankreich. Jeanne d’Arc lebte im 15. Jahrhundert. Friedrich Schiller Archiv+2Friedrich Schiller Archiv+2
Jeanne wurde als Bauerstochter in Lothringen geboren und behauptete, göttliche Stimmen empfingen zu haben, die sie beauftragten, Frankreich zum Sieg gegen England zu führen. Friedrich Schiller Archiv+1
Historisch wurde sie gefangen genommen und auf dem Scheiterhaufen in Rouen verbrannt, nachdem sie der Ketzerei beschuldigt worden war. Später wurde ihr Urteil aufgehoben. Schiller ändert gewisse historische Details für dramatische Zwecke. Friedrich Schiller Archiv+2Friedrich Schiller Archiv+2

Handlung und Aufbau
Das Drama gliedert sich in Prolog + fünf Aufzüge.
Prolog: Einführung ins einfache Leben Johanna von Dom Remy, im Kontrast zu Krieg und politischem Chaos. Ihr Vater versucht, Ehen für ihre älteren Schwestern zu arrangieren. Johanna verweigert, weil sie göttliche Berufung empfindet. Inhaltsangabe.de+2Friedrich Schiller Archiv+2
1. bis 2. Aufzug: Frankreich in Not. Johanna tritt in Erscheinung, als sich die Lage verschlechtert, und hilft den Franzosen. Charaktere wie der König Karl VII., Herzog von Burgund, die englischen Heerführer und Johanna werden eingeführt. Friedrich Schiller Archiv+2Friedrich Schiller Archiv+2
3. Aufzug: Innerer Konflikt. Johanna wird umworben, verliebt sich (gegen ihre göttliche Berufung) in Lionel, ein englischer Offizier. Es entsteht ein Zwiespalt zwischen ihrer religiösen Pflicht und persönlichen Gefühlen. Inhaltsangabe.de+2Friedrich Schiller Archiv+2
4. Aufzug: Die Öffentlichkeit und Johanna’s Rolle geraten in Frage. Ihr Vater beschuldigt sie öffentlich der Hexerei; sie wird verbal angegriffen, Unterstützung schwindet. Sie nimmt trotz ihrer Zuneigung ihre göttliche Sendung wieder ernster. Inhaltsangabe.de+2Friedrich Schiller Archiv+2
5. Aufzug / Schluss: Katastrophe und Läuterung. Johanna wird gefangen genommen, leidet, erfährt Isolation und Verleumdung. Am Ende stellt sie sich nochmals in den Dienst Frankreichs, kämpft, erreicht Sieg, wird aber schwer verwundet und stirbt – allerdings in Schillers Fassung unter der französischen Flagge sichtbar mystisch verklärt. Friedrich Schiller Archiv+1
Charaktere und zentrale Motive
Johanna ist die tragische Heldin: Sie heißt die göttliche Mission, steht im Konflikt zwischen persönlicher Liebe und religiöser Berufung, zeigt Selbstlosigkeit und Leiden. Friedrich Schiller Archiv+1
Karl VII., der König, symbolisiert politische Unsicherheit, Zögerlichkeit und Sehnsucht nach Stabilität. Friedrich Schiller Archiv+1
Lionel steht als Bild der Liebe und des Menschen, der zwischen Feindschaft und persönlicher Nähe schwankt. Inhaltsangabe.de+1
Weitere Figuren wie der Herzog von Burgund, Talbot usw. bringen politische Intrigen und Machtkonflikte ins Spiel.
Zentrale Motive:
Gottes Berufung vs. menschliche Neigung – Johanna muss sich entscheiden zwischen göttlicher Mission und menschlichen Gefühlen.
Macht und Verantwortung – Welche Rolle spielt moralische und geistige Macht im Gegensatz zu politischer und militärischer Macht?
Loyalität / Verrat – Vaterland, Vater, Glaube vs. Liebe, persönliches Glück.
Läuterung durch Leiden – Johanna wird nicht perfekt dargestellt; sie irrt, leidet und wird durch Leid geläutert.
Stilistische Besonderheiten & Einordnung
Schiller spricht von einer romantischen Tragödie. Obwohl klassisch geprägt, enthält das Werk romantische Elemente wie Mystik, religiöse Berufung, innere Wandlung. reclam.de+1
Sprache: Viele Monologe, religiös geprägte Sprache, bildhafte Motive, innerer Dialog.
Aufbau: Prolog + fünf Akte, klassische Dramenhandlung mit steigendem Konflikt, Höhepunkt, Fall, Lösung / Läuterung.
Deutung und Bedeutung
Schiller nutzt das historische Jeanne-d’Arc-Bild, um über das Verhältnis von Idealismus und Realität nachzudenken. Johanna steht für das Ideal des Selbstopfers, hat aber auch menschliche Schwächen.
Der Konflikt zwischen individueller Berufung und gesellschaftlichen Erwartungen ist zentral – relevant auch über die Zeit Schillers hinaus.
Die politische Dimension: In Schillers Zeit war Deutschland nicht geeint, es gab Gedanken über Freiheit, Nation, Verantwortung. Johanna als Symbol für das strebende Individuum und auch für nationales Bewusstsein.
Die romantische Verklärung (z. B. Ende unter französischer Flagge statt Scheiterhaufen) zeigt: Schiller will nicht nur historische Treue, sondern auch ästhetische und moralische Wirkung.
Schluss
Die Jungfrau von Orleans ist ein vielschichtiges Drama, das historische Stoffe und religiös-romantische Ideale verbindet. Schiller schafft eine Heldin, die sowohl göttlich inspiriert als auch menschlich, verletzbar und in Konflikten steht. Das Werk regt zum Nachdenken über Moral, Pflicht, Liebe und Idealismus an und bleibt bis heute relevant.
Quellen
Die Jungfrau von Orleans – Friedrich Schiller Archiv, Inhaltsangabe & Zusammenfassung. Friedrich Schiller Archiv
Jungfrau von Orleans – Erläuternde Inhaltsangabe (Schiller-Archiv). Friedrich Schiller Archiv+1
Inhaltsangabe.de – Die Jungfrau von Orleans. Inhaltsangabe.de
Reclam Verlag – Textausgabe mit Kommentar und Materialien. reclam.de